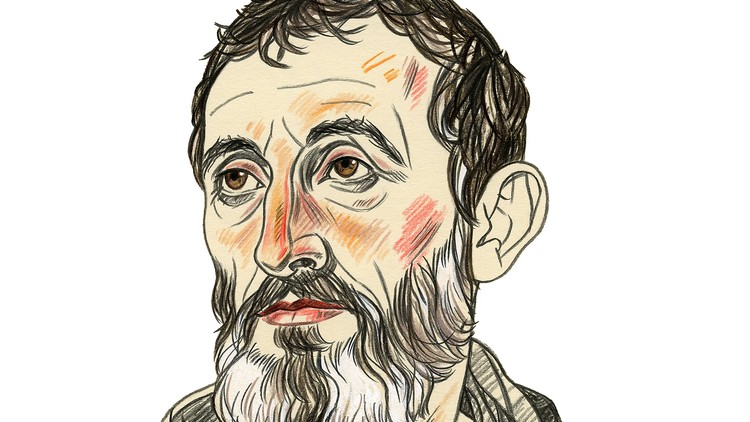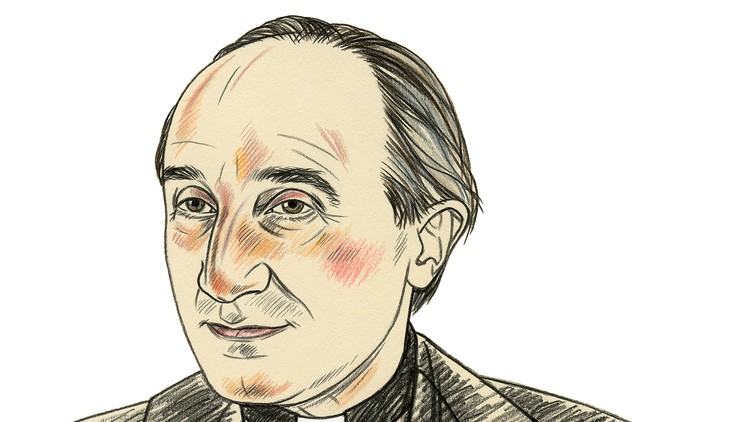«Doan ist drei jahre alt
im kopf ein splitter
der guten bombe
die keine gebäude zerstört
nie eine fabrik stillegt
selbst den brücken nichts tut»
Auszug aus dem Gedicht: Krankenhaus in Haiphong, in: Dorothee Sölle, Die revolutionäre Geduld, Berlin 1974, Seite 28 © Wolfgang Fietkau Verlag
Gedichte wie dieses zeichnen Dorothee Sölle aus. Die evangelische Theologin und Literaturwissenschaftlerin schreibt gegen himmelschreiendes Unrecht an und gibt denen eine Stimme, die nie gehört werden: Hier dem kleinen Doan, der 1972 Opfer der Bombardierungen in Vietnam geworden war. Weil Doan es noch nicht kann, schreibt Sölle für ihn am Ende ihres Gedichts den Fabrikarbeitern in den USA: Statt Bomben sollten sie doch kleine Plastikschiffchen herstellen. Sölle selbst war Kind im Dritten Reich und hatte als Jugendliche Krieg erlebt. Von zuhause nationalkonservativ geprägt, ändert sie später ihre politische Einstellung grundlegend. Seit sie ab 1965 öffentlich in Erscheinung tritt, kritisiert sie die Gesellschaft und die Kirchen, und mit der Kraft ihrer Poesie verbindet sie Politik und Religion.

Michael Stünzi
«Doan ist erst drei Jahre alt»
Dorothee Sölle. (1929–2003)
Sölle verfasst 38 Bücher, zahlreiche Aufsätze und unterrichtet an Hochschulen in Deutschland und folgt 1975 «in einer Mischung von Neugier und Kritik» an den USA einem Ruf an das Union Theological Seminary in New York. Theologie, sagt sie, dürfe nicht nur Theorie sein, denn dann bliebe sie belanglos. Deshalb versucht sie, eine Theologie zu entwickeln, die für das Leben der Menschen bedeutsam ist, indem sie von Alltagsthemen ausgeht: Aufrüstung und Gewaltfreiheit, lieben und arbeiten, zivilen Ungehorsam, Feminismus, Armut und Gerechtigkeit, die Erfahrung von Glück. Sie befasst sich mit dem Leiden und kommt darüber zum Kern der Theologie: zur Gottesfrage. Gott ist für sie kein «Es», über das man sprechen kann; auch nicht der Allmächtige, der die Menschen erniedrigt. Und Gott ist für sie kein persönliches Gegenüber, sondern er ist abwesend – liesse er sonst all das Leidvolle in der Welt geschehen? Sölle glaubt, dass Gott «passiert» und erfahrbar werden kann in allem, was zwischen Menschen geschieht, weil er ein «Gott der Beziehung» ist; als «gute Macht» ist er imstande, «uns zu verändern». Sölle geht es um das Reich Gottes: Es beginnt nicht erst am «Ende», sondern hier und heute, wenn «Gott befreiend handelt in und durch Menschen». Das Wort Gott sagt etwas über Menschen und ihre Verhältnisse aus, und wenn «Menschen so leben können, wie es der Schöpfung Gottes entspricht», in Frieden und Gerechtigkeit – dann ist das Reich Gottes da.
In Nicaragua nahm sie in den 1980er-Jahren an einem Vortrag des Aussenministers Miguel d’Escoto Brockmann teil. Brockmann, der auch Priester war, sprach über eine Kreuzwegprozession. Bis dahin sah sie in Jesus ein Vorbild im Umgang mit Menschen, einen moralischen Kompass. Doch als sie nun hört, warum die Menschen diesen Kreuzweg mitgehen, wird ihr klar, dass Jesu Passion viel wichtiger ist, denn aus ihr schöpfen die Menschen Mut für die Bewältigung ihres oft leidvollen Alltags. Es geht nicht darum, Leid zu vermeiden, sondern es leidenschaftlich zu tragen – so wie Jesus sein Kreuz getragen hatte. In dieser aktiven Gewaltlosigkeit sieht Sölle eine christliche Form des nötigen Widerstands gegen Unrecht, Gewalt und unterdrückerische Ausbeutung. Nur durch Gerechtigkeit lasse sich ein Friede im Sinne des Reiches Gottes erreichen. Dieser Friede ist mehr als das blosse Fehlen von Gewalt, er ist eine «Frucht der Gerechtigkeit». Sich dem Leiden stellen oder es sogar freiwillig auf sich nehmen und Widerstand gegen die Ursachen des Leidens leisten, dies übernimmt Sölle fortan als eigene Haltung. Indem sie Krieg, Imperialismus und Ungerechtigkeiten aller Art brandmarkt, muss sie auch die Angriffe derer aushalten, die sie mit ihrer Kritik trifft – von mündlichen Hetzkampagnen bis hin zu Drohanrufen daheim. Den Mut zum Widerstand findet sie in der Erkenntnis: «In jedem Gegenwind steckt auch ein Aufwind.»
Die politische Theologie Dorothee Sölles war moralisch klar, sie selbst aber bleibt widersprüchlich: Einerseits setzt sie sich für den Frieden in Vietnam ein und organisiert ab 1968 die Politischen Nachtgebete mit – sie besteht darauf, dass dort nicht nur politisiert, sondern auch gebetet wird. Auf der anderen Seite anerkennt sie fast unkritisch den bewaffneten Widerstand in Mittelamerika als Befreiungsversuch. Von Nächstenliebe schreibt sie an vielen Stellen, von Feindesliebe kaum etwas. Trotzdem beeindruckt und inspiriert sie viele Menschen innerhalb und ausserhalb der Kirchen. Sölles Möglichkeiten, nicht nur Mitleid zu empfinden, sondern als Schriftstellerin etwas für den «Frieden des Reiches Gottes» zu tun, scheinen gering. Doch der Widerstand, zu dem sie in ihren Schriften ermutigt, erweist sich oft als die «Stärke der Schwachen», als «Kraft der Ohnmächtigen»: Doan ist erst drei Jahre. Und alle verstehen: Was ihm geschehen ist, geschieht auch Laila, Levi, Nyota, Anouk, Andriy … Jeden Tag.
Die Schriften von Dorothee Sölle stehen in der Jesuitenbibliothek Zürich bereit:
jesuitenbibliothek.ch