Die Kirche sei mit ihrem Latein am Ende, konnte man vor Kurzem vielerorts lesen. Ist diese Nachricht mehr als ein «Fun Fact»?
Wichtige Dokumente werden weiterhin ins Lateinische übersetzt. Nur gilt das Latein in der Verwaltungspraxis der römischen Kurie jetzt nicht mehr als bevorzugte Sprache. Vermutlich werden normale Akten zukünftig kaum noch auf Latein verfasst. Diese Entwicklung zeichnete sich schon länger ab und hat auch praktische Gründe. Das Personal im Vatikan wurde immer internationaler. Man kann nicht mehr voraussetzen, dass die Menschen gut genug Latein können, um tagtäglich damit zu arbeiten.
Also ein Problem des Fachkräftemangels, auch im Vatikan…
Das könnte man so sagen. Aber es geht um mehr, nämlich um die Frage: Welche Sprache spricht die Kirche? Papst Franziskus hat immer betont, die römische Kurie solle nicht der eigenen Selbsterhaltung, sondern den Menschen dienen. Dafür muss sie aber auch deren Sprache sprechen. Diesen Gedanken setzt Leo jetzt in die Tat um.
Wird es bei der nächsten Papstwahl kein «Habemus Papam» mehr geben?
Doch, dieser Ausspruch wird sicherlich bleiben. Aber schon bei dem letzten Konklave war das Latein auf die Liturgie und auf den Ritus beschränkt. Die offizielle Verfahrenssprache war Italienisch, und untereinander diskutierten die Kardinäle in verschiedenen Sprachen.
Gianluca De Candia (42) ist Professor für Philosophie und Dialog mit der Gegenwartskultur an der Kölner Hochschule für Katholische Theologie (KHKT). Sein neuestes Buch erschien 2025 unter dem Titel «Die Dynamik des Wortes. Fortwährende Übersetzung als Prinzip christlicher Überlieferung».
Viele Stimmen und Sprachen in der Kirche, gilt das auch im übertragenen Sinne?
Auf jeden Fall. Die Kirche ist pluralistisch und mehrsprachig geworden. Und die Fragen haben sich verändert, sie sind vom jeweiligen kulturellen Kontext geprägt. Um auf die Herausforderungen der modernen Welt zu antworten, reicht der alte Wortschatz oft nicht mehr aus. Das Zweite Vatikanische Konzil (1963–1965) war der letzte Anlass, bei dem die grossen Reden in Latein gehalten wurden. Johannes XXIII. hatte dies in der apostolischen Konstitution «Veterum Sapientia» kurz vor dem Konzil so vorgegeben. Das Latein, verstanden als eine Sprache, deren Wandlungsprozess abgeschlossen ist, war seiner Meinung nach am besten geeignet, um den Glauben zu bewahren.
Schon beim Konzil entstanden dann aber neue lateinische Wortbildungen.
Das erste Konzilsdokument, das die Unveränderlichkeitserklärung des Lateins anders gewichtet hat, ist «Gaudium et spes». Es entstand in hastiger Übersetzungsarbeit und brachte Neologismen wie «civilizatio», «dissensiones raciales» oder «opinio publica» hervor, die viele Latinisten und Konzilsväter wegen ihrer Ungeschliffenheit empörten. Auch heute kursieren im Vatikan einige neue lateinische Begriffe, etwa «armárium frigidárium» für Kühlschrank. Es gibt ein «Lexikon des modernen Lateins», lateinische Sendungen bei Radio Vatikan und sogar Geldautomaten, die auf Latein bedient werden können.
Ist das Latein also doch nicht tot?
Ich halte nichts davon, so zu tun, als sei das Latein eine aktiv gesprochene Sprache. Latein sollte auf universalkirchliche Dokumente sowie auf alte liturgische und rituelle Formen beschränkt bleiben. Das Latein hat eine besondere Schönheit und eine prägnante Kraft. Man braucht viel weniger Worte als in anderen Sprachen, um dasselbe zum Ausdruck zu bringen. Gleichzeitig zeigt die Notwendigkeit, Neologismen zu bilden, dass Tradition ein lebendiger Übersetzungsprozess ist.
Was halten Sie von der vorkonziliarischen lateinischen Messe?
Oft wird das Latein grob identifiziert mit der alten Form des römischen, auch als tridentinisch bezeichneten Ritus. Das Problem ist nicht die Sprache, sondern der theologische Inhalt, der durch das Latein mittransportiert wird. Danach vollzieht sich die Liturgie mit einer weniger ausgeprägten Beteiligung der Gemeinde, sie ist ganz auf den Priester konzentriert.
Kann man die Sprache denn von den Inhalten lösen?
Die Sprache an sich ist ein Medium. Auch das «Missale Romanum» von Paul VI. aus dem Jahr 1969 liegt auf Latein vor. Die Aura des Lateinischen prägt die Tradition der katholischen Kirche; es betont ihren universalen Charakter. Das Lateinische privilegiert weder eine bestimmte Nation noch eine bestimmte Sprache. Deshalb finde ich es immer noch besser, einen Gottesdienst mit vielen verschiedenen Nationalitäten, etwa auf dem Petersplatz in Rom, auf Latein zu halten statt auf Englisch.
In Ihrem neuen Buch sagen Sie aber auch, Übersetzbarkeit, Mehrsprachigkeit und Sprachoffenheit seien konstitutiv für das Christentum.
Im Unterschied zum Judentum und später zum Islam, wo die Originalsprache der Heiligen Schriften selbst als heilig gilt, gab es schon unter den ersten Christinnen und Christen eine besondere Offenheit gegenüber den Übersetzungen der kanonisch werdenden Schriften. Schon früh übersetzten Christinnen und Christen die Paulusbriefe und dann die Evangelien in verschiedene Sprachen. Sie knüpften damit zwar an jüdisch-hellenistische Traditionen an, gingen aber noch einen Schritt weiter. Für sie war die Übersetzbarkeit der Schriften kein Mangel, sondern ein echtes Identitätsmerkmal. Das Christentum ist von Beginn an eine Religion des Wortes und der Übersetzbarkeit, nicht bloss aus historischem Zufall, sondern als Teil des theologischen Selbstverständnisses.
Die Offenheit für Übersetzungen hat also eine Bedeutung auch jenseits der Sprache?
Für mich ist die Frage der Übersetzung keineswegs nur auf sprachliche Aspekte beschränkt. Bevor die erste Zeile des Neuen Testaments niedergeschrieben wurde, lebten die frühen Christen und Christinnen in einem fortwährenden Prozess des Übersetzens, und zwar nicht nur von einer Sprache in eine andere Sprache, sondern vor allem von einer persönlichen Erfahrung in Worte. Übersetzen bedeutet, adaptiv den Sinn bewahren. Das heisst, man hält den gleichen Sinn lebendig, passt ihn aber an und transformiert ihn. Das gilt heute immer noch, auch mit Blick auf konkrete, praxisrelevante Fragen.
Worin gründet die Offenheit des Christentums gegenüber der sprachlichen Vielfalt?
Im Zentrum des Christentums steht nicht ein heiliger Text, sondern eine lebendige Person, Jesus Christus, der Mensch gewordene Gott. Das macht einen entscheidenden Unterschied. Die Verkündigung der Auferstehung Jesu soll jede und jeden erreichen können, unabhängig von der ethnischen Zugehörigkeit, und darf deshalb in jede Sprache der Welt übersetzt werden. Allerdings haben das Griechische und später das Lateinische in der Geschichte des Christentums eine besondere Rolle gespielt. Sie waren Weltherrschaftssprachen, Sprachen des Austauschs, der Bildung, der Mission und tragen bis heute ein Symbol in sich: Sie erinnern an die universale Sendung der Kirche und an die Einheit, die wir in Christus finden.
Das Interview ist zuerst in der Printausgabe des Pfarrblatt Bern erschienen.
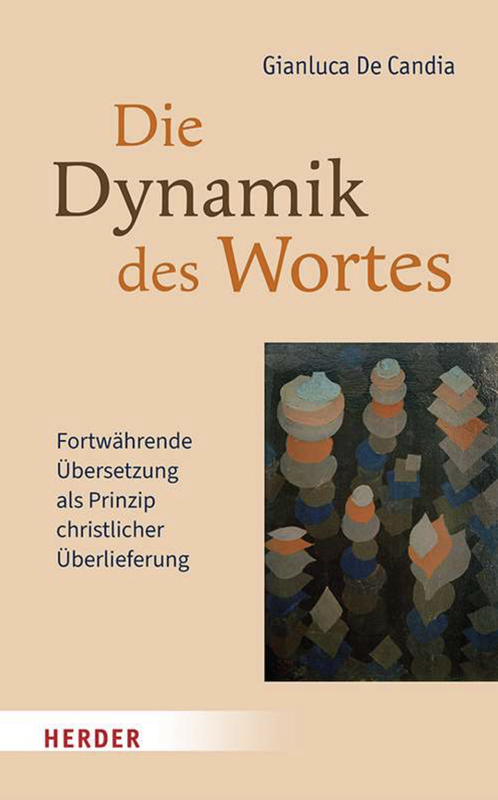
Screenshot
erschienen 2025
im Herder Verlag
ISBN 978-3-451-02452-8
aus der Buchbeschreibung:
«Gianluca De Candia liest die Entstehungsgeschichte des Christentums neu, indem er das Christuskerygma als Artikulation einer Bedeutsamkeitserfahrung (‹Mal-Setzung›), das Neue Testament und die konziliar normierte Sondersprache als extensionalen Übersetzungsprozesse innerhalb einer bestimmten Interpretationsgemeinschaft beschreibt, in denen immer ‹dasselbe› und doch je ‹anders› gesagt wurde und sich dabei immer ‹gleicher› geworden ist.»
